Dass das der falsche Weg ist, um die Beiträge zu stabilisieren, davon sind Jochen Pimpertz, Leiter Themencluster Staat, Steuern und Soziale Sicherung, Ruth Maria Schüler und Maximilian Stockhausen, beide Senior-Volkswirte für Soziale Sicherung und Verteilung am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, überzeugt.
Der Grund: Eine erweiterte Versicherung würde neue Risiken absichern, die bisher gar nicht versichert sind – sie würde also mehr kosten, nicht weniger. Außerdem könnte es aus Sicht der Wissenschaftler Probleme mit Trittbrettfahrern geben, also Menschen, die sich absichtlich nicht absichern. Denn einkommensstärkere und vermögende Haushalte könnten versucht sein, auf eigene Vorsorge zu verzichten. Stattdessen könnten sie ihr Geld für andere Zwecke ausgeben und im Pflegefall auf Zuschüsse aus dem Steuerhaushalt hoffen.
Fünf von zehn Rentnerhaushalten können sich die Pflegekosten für eine Person bis zu fünf Jahre leisten
Gegen dieses Trittbrettfahrer-Argument spricht allerdings, dass Personen ohnehin erst staatliche Hilfe erhalten, wenn sie ihr eigenes Geld verbraucht haben. Außerdem spricht dagegen, dass deutsche Haushalte zum Übergang in den Ruhestand über das höchste Vermögen verfügen. Zusammen mit ihrem Alterseinkommen wären deshalb rund fünf von zehn Rentnerhaushalten in der Lage, die Pflegekosten bei stationärer Versorgung für eine Person bis zu fünf Jahre aus eigener Kraft zu bezahlen.
Berücksichtigt man, dass sie dafür auch eine selbstgenutzte Immobilie beleihen können, dann wären es sogar sieben von zehn Rentnerhaushalten. Außerdem würden wohlhabende Rentnerhaushalte von einer erweiterten Versicherungspflicht profitieren. Denn ihr Einkommen bliebe im Pflegefall verschont und das Vermögen fiele im Zweifel den Erben zu.
Fraglich ist daher aus Sicht der IW-Experten, ob mit dieser Maßnahme der Sozialstaat effizienter wird. Zwar würde sie Kostenträger steuerfinanzierter Hilfen entlasten. Denn die Eigenanteile bei stationärer Pflege sinken um die zusätzliche Versicherungsleistung. Deshalb sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, im Pflegefall auf steuerfinanzierte Hilfen angewiesen zu sein.
Ausgleichszahlungen für Ärmere wären teuer und unpraktisch
Um ärmere Menschen vor den zusätzlichen Beiträgen zu schützen, müsste der Staat Ausgleichszahlungen bereitstellen – das wäre teuer und unpraktisch. Gleichzeitig würde aber ein Einkommensausgleich notwendig, damit einkommensschwache Haushalte, egal welchen Alters, nicht durch die erforderliche Zusatzprämie über Gebühr belastet werden. Das kostet nicht nur viel Geld. Der Einkommensausgleich wäre auch weniger treffsicher, weil eine Prüfung der Vermögensverhältnisse entfällt.
Unabhängig vom aktuellen Vorschlag, sollten die Politiker aus Sicht der IW-Experten auf keinen Fall beschließen, die bislang privaten Eigenanteile an den Pflegekosten über die soziale Pflegeversicherung zu finanzieren. Auf diese Weise würden das Finanzloch und der Beitragssatz noch stärker steigen.
Statt die Eigenanteile über die Pflegeversicherung zu finanzieren, empfehlen sie, innerhalb der Pflegeversicherung einen Kapitalstock aufzubauen, um Beiträge langfristig stabil zu halten und jüngere Generationen zu entlasten.


 Lesedauer: ca. 02:15 Min
Lesedauer: ca. 02:15 Min 




































































































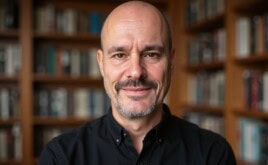


























0 Kommentare
- anmelden
- registrieren
kommentieren